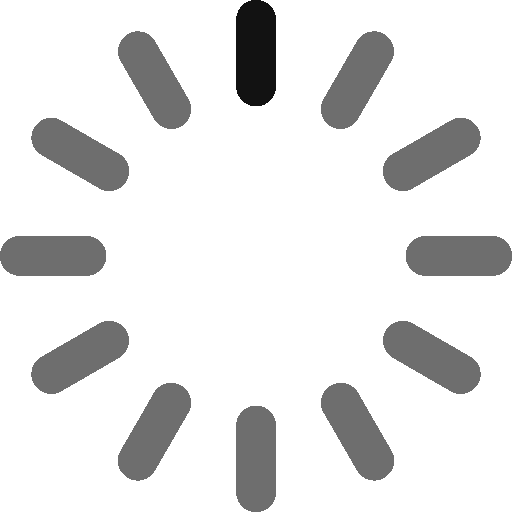Geschlossene Schrittmotoren sind möglicherweise die beste Wahl für Aufgaben, die typischerweise von Servomotoren ausgeführt werden, da herkömmliche Schrittmotoren diese nicht bewältigen können.
Eine der wichtigsten Entscheidungen, die Ingenieure bei der Entwicklung von Bewegungssteuerungssystemen treffen müssen, ist die Wahl des Motors. Die Auswahl des richtigen Motors hinsichtlich Typ und Größe ist entscheidend für die Betriebseffizienz der fertigen Maschine. Darüber hinaus ist die Einhaltung des Budgets stets ein zentrales Anliegen.
Eine der ersten Fragen, die bei der Entscheidungsfindung beantwortet werden muss, lautet: Welcher Motortyp ist am besten geeignet? Benötigt die Anwendung einen Hochleistungs-Servomotor? Wäre ein kostengünstiger Schrittmotor besser? Oder gibt es vielleicht eine dritte, mittlere Option, die in Betracht gezogen werden sollte?
Die Antworten beginnen mit den Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Viele Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor der für eine bestimmte Anwendung ideale Motortyp bestimmt werden kann.
Die Anforderungen
Wie viele Umdrehungen pro Minute muss der Motor ausführen? Welches Drehmoment wird benötigt? Welche Spitzendrehzahl ist erforderlich?
Diese entscheidenden Fragen lassen sich nicht einfach durch die Wahl eines Motors mit einer bestimmten PS-Zahl beantworten.
Die Leistungsabgabe eines Motors ist die Kombination aus Drehmoment und Drehzahl, die durch Multiplikation von Drehzahl, Drehmoment und einer Konstanten berechnet werden kann.
Aufgrund der Art dieser Berechnung gibt es jedoch viele verschiedene Kombinationen von Drehmoment und Drehzahl, die zu einer bestimmten Leistungsabgabe führen. Daher können unterschiedliche Motoren mit ähnlicher Nennleistung je nach der von ihnen gebotenen Kombination aus Drehzahl und Drehmoment unterschiedlich arbeiten.
Ingenieure müssen wissen, wie schnell eine Last bestimmter Größe bewegt werden muss, bevor sie den optimalen Motor auswählen können. Die auszuführende Aufgabe muss zudem innerhalb der Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie des Motors liegen. Diese Kennlinie zeigt, wie sich das Drehmoment des Motors im Betrieb verändert. Durch die Annahme von Worst-Case-Szenarien (d. h. die Bestimmung des maximalen und minimalen Drehmoments und der erforderlichen Drehzahl) können Ingenieure sicherstellen, dass der gewählte Motor über eine ausreichende Drehmoment-Drehzahl-Kennlinie verfügt.
Die Trägheit der Last ist ein weiterer Faktor, der vor der Auswahl eines Motors berücksichtigt werden sollte. Das Trägheitsverhältnis muss berechnet werden, also das Verhältnis der Trägheit der Last zur Trägheit des Motors. Eine Faustregel besagt: Ist die Lastträgheit größer als das Zehnfache der Rotorträgheit, kann die Motorabstimmung schwieriger und die Leistung beeinträchtigt werden. Diese Regel variiert jedoch nicht nur je nach Technologie, sondern auch je nach Hersteller und sogar je nach Produkt. Die Kritikalität der Anwendung beeinflusst die Entscheidung ebenfalls. Manche Produkte verarbeiten Verhältnisse bis zu 30:1, Direktantriebe sogar bis zu 200:1. Viele Anwender bevorzugen Motoren mit einem Verhältnis von über 10:1.
Schließlich stellt sich die Frage nach physikalischen Einschränkungen, die bestimmte Motoren gegenüber anderen ausschließen. Motoren gibt es in verschiedenen Formen und Größen. Manche Motoren sind groß und sperrig, und für bestimmte Anwendungen eignen sie sich nicht. Bevor eine fundierte Entscheidung für den optimalen Motortyp getroffen werden kann, müssen diese physikalischen Spezifikationen bekannt und verstanden werden.
Sobald die Ingenieure all diese Fragen – Drehzahl, Drehmoment, Leistung, Lastträgheit und physikalische Grenzen – beantwortet haben, können sie die effizienteste Motorgröße ermitteln. Der Entscheidungsprozess ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Ingenieure müssen auch herausfinden, welcher Motortyp am besten zur jeweiligen Anwendung passt. Jahrelang beschränkte sich die Wahl des Motortyps für die meisten Anwendungen auf eine von zwei Optionen: einen Servomotor oder einen Schrittmotor mit offener Regelung.
Servos und Schrittmotoren
Die Funktionsprinzipien von Servo- und Open-Loop-Schrittmotoren sind ähnlich. Es gibt jedoch wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Motorentypen, die Ingenieure verstehen müssen, bevor sie entscheiden, welcher Motor für eine bestimmte Anwendung am besten geeignet ist.
In herkömmlichen Servosystemen sendet ein Controller Befehle über Impulse und Richtung oder analoge Signale, die Position, Drehzahl oder Drehmoment betreffen, an den Motorantrieb. Einige Controller nutzen ein busbasiertes Verfahren, bei modernen Systemen typischerweise Ethernet. Der Antrieb steuert dann jede Phase des Motors mit dem entsprechenden Strom an. Die Motordaten werden an den Antrieb und gegebenenfalls an den Controller zurückgesendet. Der Antrieb benötigt diese Informationen, um den Motor korrekt zu kommutieren und präzise Informationen über die dynamische Position der Motorwelle zu übermitteln. Servomotoren gelten daher als geschlossene Regelkreise und verfügen über integrierte Encoder. Positionsdaten werden häufig an den Controller übermittelt. Diese Rückmeldung ermöglicht dem Controller eine präzisere Motorsteuerung. Bei Abweichungen kann der Controller die Betriebsabläufe in unterschiedlichem Maße anpassen. Diese Art von wichtigen Informationen ist ein Vorteil, den offene Schrittmotoren nicht bieten können.
Schrittmotoren arbeiten mit Ansteuersignalen, die die zurückgelegte Strecke und die Geschwindigkeit vorgeben. Typischerweise handelt es sich dabei um ein Schritt- und Richtungssignal. Allerdings geben Schrittmotoren im offenen Regelkreis kein Feedback an den Bediener, sodass ihre Steuerung die jeweilige Situation nicht adäquat erfassen und Anpassungen zur Optimierung des Motorbetriebs vornehmen kann.
Reicht beispielsweise das Drehmoment eines Motors nicht aus, um die Last zu bewältigen, kann der Motor blockieren oder einzelne Schritte auslassen. In diesem Fall wird die Zielposition nicht erreicht. Aufgrund der Eigenschaften des Schrittmotors im offenen Regelkreis wird diese ungenaue Positionierung nicht ausreichend an die Steuerung zurückgemeldet, sodass diese keine Korrekturen vornehmen kann.
Servomotoren bieten offensichtlich klare Vorteile hinsichtlich Effizienz und Leistung. Warum also sollte man sich für einen Schrittmotor entscheiden? Dafür gibt es mehrere Gründe. Der häufigste ist der Preis; Betriebskosten spielen bei jeder Konstruktionsentscheidung eine wichtige Rolle. Angesichts knapper werdender Budgets müssen unnötige Kosten eingespart werden. Dies betrifft nicht nur die Kosten des Motors selbst, sondern auch die Kosten für routinemäßige und Notfallwartung. Diese sind bei Schrittmotoren in der Regel günstiger als bei Servomotoren. Wenn die Vorteile eines Servomotors dessen Kosten nicht rechtfertigen, kann ein Standard-Schrittmotor ausreichend sein.
Rein betriebstechnisch betrachtet sind Schrittmotoren deutlich einfacher zu handhaben als herkömmliche Servomotoren. Die Bedienung eines Schrittmotors ist wesentlich einfacher zu verstehen und zu konfigurieren. Die meisten Anwender würden zustimmen: Wenn es keinen Grund gibt, die Bedienung unnötig zu verkomplizieren, sollte man die Dinge so einfach wie möglich halten.
Die Vorteile der beiden Motortypen unterscheiden sich deutlich. Servomotoren sind ideal, wenn Drehzahlen über 3.000 U/min und ein hohes Drehmoment benötigt werden. Für Anwendungen mit Drehzahlen von nur wenigen hundert U/min oder weniger ist ein Servomotor jedoch nicht immer die beste Wahl. Für Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen können Servomotoren überdimensioniert sein.
Bei Anwendungen mit niedriger Drehzahl spielen Schrittmotoren ihre Stärken voll aus und sind die optimale Lösung. Sie zeichnen sich nicht nur durch präzises Anhalten aus, sondern sind auch für den Betrieb mit niedriger Drehzahl bei gleichzeitig hohem Drehmoment ausgelegt. Dank dieser Bauart lassen sich Schrittmotoren präzise steuern und bis an ihre Drehzahlgrenze betreiben. Die Drehzahlgrenze typischer Schrittmotoren liegt üblicherweise unter 1.000 U/min, während Servomotoren Nenndrehzahlen von bis zu 3.000 U/min und mehr erreichen können – manchmal sogar über 7.000 U/min.
Bei korrekter Dimensionierung kann ein Schrittmotor die optimale Wahl sein. Läuft ein Schrittmotor jedoch im offenen Regelkreis und es tritt eine Störung auf, erhalten die Bediener möglicherweise nicht alle zur Fehlerbehebung notwendigen Daten.
Lösung des Open-Loop-Problems
In den letzten Jahrzehnten wurden verschiedene Ansätze zur Lösung der bekannten Probleme von Schrittmotoren im offenen Regelkreis vorgeschlagen. Eine Methode bestand darin, den Motor beim Einschalten oder sogar mehrmals während des Betriebs an einen Sensor anzufahren. Obwohl diese Methode einfach ist, verlangsamt sie den Betrieb und erfasst keine Probleme, die während des normalen Betriebs auftreten.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, Rückmeldungen hinzuzufügen, um zu erkennen, ob der Motor blockiert oder seine Position verändert. Ingenieure von Unternehmen im Bereich der Bewegungssteuerung haben Funktionen zur Blockiererkennung und Positionsstabilität entwickelt. Es gibt sogar einige Ansätze, die noch weiter gehen und Schrittmotoren ähnlich wie Servomotoren behandeln oder diese zumindest mithilfe komplexer Algorithmen nachbilden.
Im breiten Spektrum der Motoren – zwischen Servomotoren und offenen Schrittmotoren – findet sich eine relativ neue Technologie: der geschlossene Schrittmotor. Er ist die beste und kostengünstigste Lösung für Anwendungen, die Positionsgenauigkeit und niedrige Drehzahlen erfordern. Durch den Einsatz hochauflösender Rückkopplungssensoren zur Regelung des Regelkreises profitieren Ingenieure von den Vorteilen beider Welten.
Geschlossene Schrittmotoren bieten alle Vorteile von Schrittmotoren: einfache Handhabung, unkomplizierte Bedienung und die Fähigkeit, auch bei niedrigen Drehzahlen gleichmäßig zu laufen und präzise anzuhalten. Zusätzlich bieten sie die gleichen Rückkopplungsfunktionen wie Servomotoren. Glücklicherweise entfällt dabei der größte Nachteil von Servomotoren: der höhere Preis.
Der Schlüssel lag schon immer in der Funktionsweise von Schrittmotoren im offenen Regelkreis. Sie besitzen typischerweise zwei, manchmal fünf Spulen, zwischen denen ein magnetisches Gleichgewicht herrscht. Bewegungen stören dieses Gleichgewicht, wodurch die Motorwelle elektrisch nachhinkt. Der Bediener kann jedoch nicht feststellen, wie weit der Rückstand beträgt. Der Stopppunkt ist bei Schrittmotoren im offenen Regelkreis zwar reproduzierbar, aber nicht unter allen Lasten. Durch den Einsatz eines Encoders und die Umwandlung in einen geschlossenen Regelkreis wird eine dynamische Steuerung ermöglicht. Dadurch kann der Bediener den Motor unter verschiedenen Lasten exakt an einer bestimmten Position anhalten.
Die Vorteile von Schrittmotoren mit geschlossenem Regelkreis für bestimmte Anwendungen haben deren Beliebtheit in der Bewegungssteuerungsbranche deutlich gesteigert. Insbesondere in zwei wichtigen Branchen, der Halbleiter- und der Medizintechnik, ist ein klarer Anstieg des Einsatzes von Schrittmotoren mit geschlossenem Regelkreis zu verzeichnen. Ingenieure in diesen Branchen müssen genau wissen, wo die Motoren Lasten oder Aktoren positionieren, sei es über einen Riemen oder eine Kugelumlaufspindel. Die Rückmeldung im geschlossenen Regelkreis dieser Schrittmotoren ermöglicht ihnen diese präzise Positionsbestimmung. Zudem bieten diese Schrittmotoren bei niedrigeren Drehzahlen eine bessere Performance als Servomotoren.
Generell eignen sich alle Anwendungen, die eine garantierte Leistung zu geringeren Kosten als ein Servomotor benötigen und die Fähigkeit erfordern, mit relativ niedrigen Geschwindigkeiten zu laufen, gut für Closed-Loop-Schrittmotoren.
Beachten Sie, dass die Bediener sicherstellen müssen, dass der Antrieb oder die Steuerung Closed-Loop-Schrittmotoren unterstützt. Früher gab es Schrittmotoren mit Encoder, deren Antriebe jedoch Standard-Schrittmotorantriebe waren und keine Encoder unterstützten. Der Encoder musste daher an die Steuerung angeschlossen und die Position am Ende jeder Bewegung überprüft werden. Dies ist bei modernen Closed-Loop-Schrittmotorantrieben nicht mehr erforderlich. Diese können Position und Drehzahl dynamisch und automatisch regeln, ohne dass eine Steuerung benötigt wird.
Veröffentlichungsdatum: 06. Mai 2021