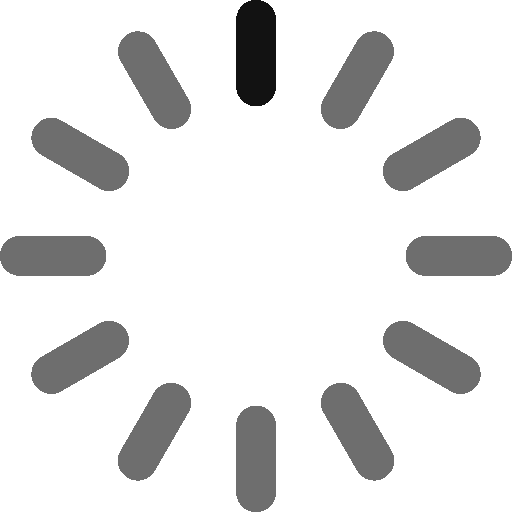Linearmotoren bieten eine überragende Leistung und eignen sich daher hervorragend für Medizintechnik, industrielle Automatisierung, Verpackungstechnik und Halbleiterfertigung. Darüber hinaus verbessern moderne Linearmotoren die Kosten, die Wärmeentwicklung und die Integrationskomplexität früherer Versionen. Zur Erinnerung: Linearmotoren bestehen aus einer Spule (Primärteil oder Kraftgeber) und einer stationären Plattform, die auch als Platte oder Sekundärteil bezeichnet wird. Es gibt zahlreiche Untertypen, die beiden gängigsten für die Automatisierung sind jedoch bürstenlose Linearmotoren mit Eisenkern und eisenlose Linearmotoren.
Linearmotoren sind mechanischen Antrieben im Allgemeinen überlegen. Sie sind in unbegrenzter Länge einsetzbar. Da sie nicht die Elastizität und das Spiel mechanischer Systeme aufweisen, sind Genauigkeit und Wiederholgenauigkeit hoch und bleiben über die gesamte Lebensdauer der Maschine konstant. Tatsächlich benötigen nur die Führungslager eines Linearmotors Wartung; alle anderen Komponenten sind verschleißfrei.
Wo sich Linearmotoren mit Eisenkern auszeichnen
Linearmotoren mit Eisenkern besitzen Primärspulen um einen Eisenkern. Die Sekundärspule besteht üblicherweise aus einer stationären Magnetbahn. Linearmotoren mit Eisenkern eignen sich gut für Spritzguss-, Werkzeugmaschinen und Pressen, da sie eine hohe, kontinuierliche Kraft abgeben. Ein Nachteil ist jedoch das Rastmoment, das bei Linearmotoren mit Eisenkern auftreten kann. Dieses Rastmoment entsteht durch die variable magnetische Anziehungskraft der Sekundärspule auf die Primärspule während der Bewegung entlang der Magnetbahn. Die Rastkraft ist hierfür verantwortlich. Hersteller versuchen, das Rastmoment auf verschiedene Weise zu beheben, doch es ist problematisch, wenn gleichmäßige Hübe im Vordergrund stehen.
Trotzdem bieten Linearmotoren mit Eisenkern zahlreiche Vorteile. Die stärkere magnetische Kopplung (zwischen Eisenkern und Statormagneten) sorgt für eine hohe Kraftdichte. Daher erreichen Linearmotoren mit Eisenkern eine höhere Kraftabgabe als vergleichbare Linearmotoren ohne Eisenkern. Zudem leiten diese Motoren viel Wärme ab, da der Eisenkern die von der Spule erzeugte Wärme während des Betriebs abführt – wodurch der Wärmewiderstand zwischen Spule und Umgebung besser reduziert wird als bei Motoren ohne Eisenkern. Schließlich lassen sich diese Motoren leicht integrieren, da sich Kraftgeber und Stator direkt gegenüberliegen.
Eisenlose Linearmotoren für schnelle Hübe
Eisenlose Linearmotoren verzichten auf Eisen in ihrer Primärwicklung und sind daher leichter, wodurch dynamischere Bewegungen ermöglicht werden. Die Spulen sind in eine Epoxidplatte eingebettet. Die meisten eisenlosen Linearmotoren verfügen über U-förmige Führungsbahnen, deren Innenflächen mit Magneten ausgekleidet sind. Durch Wärmeentwicklung kann die Schubkraft im Vergleich zu Motoren mit Eisenkern geringer ausfallen, einige Hersteller begegnen diesem Problem jedoch mit innovativen Kanal- und Primärgeometrien.
Kurze Einschwingzeiten verbessern die Dynamik eisenloser Linearmotoren und ermöglichen so schnelle und präzise Bewegungen. Da keine Anziehungskräfte zwischen Primär- und Sekundärteil bestehen, sind eisenlose Linearmotoren zudem einfacher zu montieren als Motoren mit Eisenkern. Ihre Stützlager sind außerdem keinen magnetischen Kräften ausgesetzt und haben daher in der Regel eine längere Lebensdauer.
Beachten Sie, dass Linearmotoren bei vertikalen Achsen und in rauen Umgebungen Probleme haben. Das liegt daran, dass Linearmotoren (die prinzipiell berührungslos arbeiten) ohne Bremsung oder Gegengewicht die Last bei Stromausfall absinken lassen.
Darüber hinaus können in rauen Umgebungen Staub und Späne entstehen, die sich an Linearmotoren festsetzen, insbesondere bei der Bearbeitung von Metallteilen. Hier sind Linearmotoren mit Eisenkern (und ihre magnetgefüllte Laufbahn) besonders anfällig. Einige Aktuatoren verwenden daher Linearmotoren mit Eisenkern oder eisenlose Linearmotoren und sind staubdicht konstruiert, um in solchen Umgebungen eingesetzt werden zu können. Letzteres beseitigt die Probleme, die mit den üblicherweise zum Schutz von Linearachsen verwendeten Faltenbälgen verbunden sind.
Wann sollte man integrierte Linearmotorantriebe wählen?
Die Direktantriebsfunktion von Linearmotoren steigert die Produktivität und Systemdynamik in zahlreichen industriellen Anwendungen. Einige Linearmotoren verfügen zudem über Positionsgeber zur Positionsrückmeldung, was die Handhabung im Vergleich zu Riemen- und Kugelgewindetrieben deutlich vereinfacht. Manche dieser Aktuatoren integrieren Linearmotor, Führung und optischen (oder magnetischen) Geber, um die Leistungsdichte weiter zu erhöhen.
Bei einigen Aktuatoren ist der Encoder horizontal montiert, sodass seine Position durch äußere Einflüsse nicht beeinträchtigt wird. Solche Anordnungen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 6 m/s und Beschleunigungen von bis zu 60 m/s² bei einer Eingangsspannung von 230 V AC. Module mit Verfahrwegen von über zwei Metern sind möglich. Standardmäßig ist ein magnetischer Encoder zur Positionsrückmeldung enthalten; für höhere Präzision sind jedoch auch optische Encoder erhältlich. Weitere Optionen umfassen Mehrschlitten-Systeme sowie komplette XY- und Portalsysteme.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kugelgewindetrieben bieten Aktuatoren mit Linearmotoren dank Direktantrieb eine höhere Präzision und Geschwindigkeit – selbst unter verschiedensten Schubkraftbedingungen. Die engere Integration steigert zudem Produktivität und Zuverlässigkeit. Solche Aktuatoren bestehen beispielsweise aus dem Linearmotor selbst, einem Sockel und einer breiten Linearführung mit Aluminiumschlitten und optischer Skala zur Positionsrückmeldung. Ist der Linearmotor eisenlos, kann er mit einem Aluminiumschlitten zu einer leichten und schnell beschleunigenden Konstruktion kombiniert werden.
Einige kompakte Linearantriebe verfügen über Schlitten mit integrierten Schmierpads für eine umweltfreundliche Schmierung. Hierbei sind die Enden des Laufblocks mit hermetisch abgedichteten Fettinjektoren ausgestattet, die die Laufbahnen mittels Kugelschmierung schmieren. Optional erhältliche Schmierpads sorgen in manchen Fällen für zusätzliche Schmierung und einen wartungsärmeren Langzeitbetrieb, insbesondere bei Achsen mit kurzen Hüben.
Eisenlose Linearmotoren in einigen Aktuatoren weisen ebenfalls kein Rastmoment auf, sodass die Achse sowohl bei langsamen als auch bei schnellen Bewegungen stabile Bewegungen ausführen kann. Bei manchen Ausführungen beträgt die Wiederholgenauigkeit mit einem optischen Linear-Encoder 2 mm. Einige Aktuatoren sind sogar mit Hüben von 152 bis 1490 mm und einer Geradheit von 6 bis 30 mm erhältlich.
Spezielles Beispiel: Reinraumanwendungen
Eine letzte Option, die sich besonders für Anwendungen mit kurzen Hüben und hohen Taktzahlen eignet, sind Linearmotorantriebe, bei denen die beweglichen Teile Magnete und Schiene sind. Hier gibt es keine Probleme mit beweglichen Kabeln, die zu Verbindungsunterbrechungen führen könnten. Auch staubige Umgebungen stellen kein Problem dar. Tatsächlich funktionieren die Antriebe selbst in Vakuumumgebungen und Reinräumen einwandfrei. Das liegt daran, dass die Spulen fest montiert sind und die Wärme daher leicht an die Montagevorrichtungen abgeleitet wird. Einige dieser Linearmotorantriebe liefern eine Dauerkraft von bis zu 94,2 oder 188,3 N und eine Spitzenkraft von bis zu 242,1 oder 484,2 N – bei einem Dauerstrom von 3,5, 7 oder 14 A, je nach Ausführung. Der Hub beträgt bis zu 430 mm.
Parameter zur Spezifizierung von Linearmotorstufen
Bei der Spezifizierung von Aktuatoren oder Positioniereinheiten auf Basis von Linearmotoren sind für jeden Abschnitt des Bewegungsprofils der Konstruktion die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:
• Was ist die bekannte Bewegungsbedingung?
• Wie groß sind die Masse der Last, die Systemmasse, der effektive Hub, die Bewegungszeit und die Verweilzeit?
• Wie lauten die Ansteuerbedingungen, die maximale Ausgangsspannung sowie der Dauer- und Spitzenstrom?
• Welche Art von Encoderauflösung benötigt das System? Sollte sie analog oder digital sein?
• In welcher Arbeitsumgebung wird der Aktor bzw. die Bühne eingesetzt? Wie hoch wird die Raumtemperatur sein? Wird die Maschine Vakuum- oder Reinraumbedingungen ausgesetzt sein?
• Welche Anforderungen stellt die Anwendung an die Bewegungsgenauigkeit und die Positioniergenauigkeit?
• Bewegt der Linearmotor bzw. der Lineartisch Lasten horizontal, vertikal oder schräg? Wird die Konstruktion an einer Wand montiert? Gibt es Platzbeschränkungen?
Die Beantwortung dieser Fragen wird den Konstruktionsingenieuren helfen, die am besten geeignete Linearmotor-Variante für eine bestimmte Maschine zu ermitteln.
Veröffentlichungsdatum: 09. Mai 2023