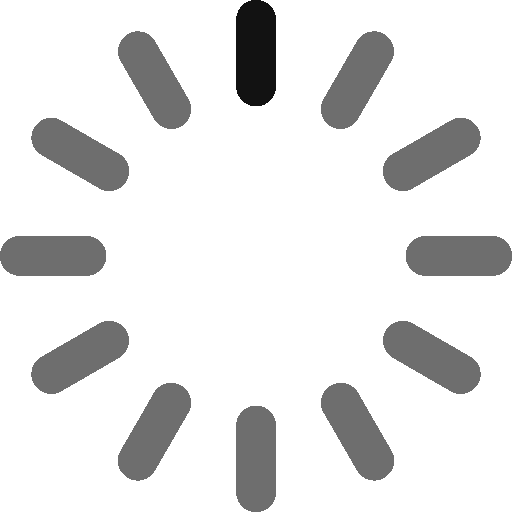Lineares Achsen-Servosystem
Heutige AC-Servosysteme unterscheiden sich deutlich von denen, die noch vor zehn Jahren gebaut wurden. Schnellere Prozessoren und hochauflösende Encoder ermöglichen den Herstellern erstaunliche Fortschritte in der Abstimmungstechnologie. Modellprädiktive Regelung und Schwingungsdämpfung sind zwei solcher Fortschritte, die sich selbst in komplexen Servosystemen erfolgreich anwenden lassen.
Die Servo-Abstimmung bei Wechselstrom-Servosystemen bezeichnet die Anpassung der Reaktion des elektrischen Steuerungssystems an ein angeschlossenes mechanisches System. Ein elektrisches Steuerungssystem besteht aus einer SPS oder einem Bewegungscontroller, der Signale an den Servoverstärker sendet und so den Servomotor veranlasst, das mechanische System zu bewegen.
Der Servomotor – ein elektromechanisches Gerät – dient als entscheidende Komponente, die die beiden Systeme verbindet. Innerhalb des elektrischen Steuerungssystems lässt sich viel tun, um das Verhalten des mechanischen Systems vorherzusagen.
In diesem Artikel werden wir zwei Techniken der modernen Servo-Tuning-Technologie – die modellprädiktive Regelung (MPC) und die Schwingungsdämpfung – sowie deren anwendungsbezogene Überlegungen untersuchen.
CPU-Geschwindigkeit – schneller als je zuvor
Höhere CPU-Geschwindigkeiten sind allgegenwärtig, und Servoverstärker bilden da keine Ausnahme. CPUs, die früher unerschwinglich waren, sind mittlerweile in der Servoverstärkerentwicklung angekommen und ermöglichen komplexere und effektivere Abstimmungsalgorithmen. Vor zehn Jahren waren Bandbreiten von 100 oder 200 Hz im Drehzahlregelkreis üblich, heute liegen die Geschwindigkeiten deutlich über 1000 Hz.
Über die Lösung von Regelkreisen hinaus ermöglichen schnellere Prozessoren Servoverstärkern die Echtzeitanalyse von Drehmoment, Drehzahl und Position, um bisher unerfassbare Maschineneigenschaften zu ermitteln. Komplexe mathematische Modelle lassen sich nun kostengünstig in Servoverstärkern implementieren, um fortschrittliche Regelalgorithmen zu nutzen, die weit über die Standard-PID-Regelung hinausgehen.
Darüber hinaus kann ein schnellerer Prozessor auch die Daten eines höher auflösenden Encoders verarbeiten, obwohl die höhere Auflösung die Positioniergenauigkeit des Systems nicht verbessert. Der limitierende Faktor für die Positionierung ist üblicherweise das mechanische System, nicht der Encoder. Ein höher auflösender Encoder ermöglicht es dem Steuerungssystem jedoch, Mikrobewegungen im mechanischen System zu erfassen, die mit einem niedrig auflösenden Encoder nicht detektierbar wären. Diese kleinen Bewegungen sind oft die Folge von Vibrationen oder Resonanz und können, falls sie erfasst werden, wichtige Daten zum Verständnis, zur Vorhersage und zur Kompensation des Verhaltens des mechanischen Systems liefern.
Die Grundlagen der modellprädiktiven Regelung
Kurz gesagt, nutzt die modellprädiktive Regelung das bisherige Sollprofil, um zukünftiges Drehmoment und Drehzahl vorherzusagen. Sind Drehzahl und Drehmoment für eine bestimmte Bewegung annähernd bekannt, muss das Bewegungsprofil nicht blind durch die PID-Regler geleitet werden, die nur auf Fehler reagieren. Stattdessen werden die vorhergesagten Werte für Drehzahl und Drehmoment als Vorsteuerung an die Servoregler übergeben, die dann den verbleibenden minimalen Fehler ausgleichen.
Damit dies korrekt funktioniert, benötigt der Verstärker ein gültiges mathematisches Modell der Maschine, basierend auf Eigenschaften wie Trägheit, Reibung und Steifigkeit. Anschließend können das Drehmoment- und Drehzahlprofil des Modells in die Servoregelkreise eingespeist werden, um die Leistung zu steigern. Diese Modelle verwenden komplexe mathematische Funktionen, doch dank schnellerer Prozessoren in Servoverstärkern finden sie zunehmend Anwendung in der Bewegungssteuerungsindustrie.
Trotz ihrer vielen Vorteile weist die modellprädiktive Regelung einen Kompromiss auf: Sie eignet sich hervorragend für die Punkt-zu-Punkt-Positionierung, führt jedoch während der Bewegung zu einer Zeitverzögerung. Diese Zeitverzögerung ist der modellprädiktiven Regelung inhärent, da die jüngste Bewegung zur Vorhersage der zukünftigen Reaktion herangezogen wird. Aufgrund dieser Verzögerung wird das vom Regler vorgegebene Sollprofil möglicherweise nicht exakt befolgt; stattdessen wird ein ähnliches Profil generiert, das am Ende der Bewegung eine schnelle Positionierung ermöglicht.
Schwingungsdämpfung
Einer der größten Vorteile der modellprädiktiven Regelung (MPC) ist die Möglichkeit, niederfrequente Schwingungen in der Maschine zu modellieren, vorherzusagen und zu unterdrücken. Schwingungen können in Maschinen mit Frequenzen von wenigen Hertz bis hin zu mehreren tausend Hertz auftreten. Niederfrequente Schwingungen im Bereich von 1 bis 10 Hertz – die oft zu Beginn und am Ende einer Bewegung wahrnehmbar sind – sind besonders problematisch, da sie innerhalb der Betriebsfrequenz der Maschine liegen.
Bestimmte Gerätekonfigurationen (z. B. Maschinen mit einem langen, schlanken Greiferarm) weisen diese niedrige Resonanzfrequenz häufiger auf als andere. Solche vibrationsanfälligen Konstruktionen können aufgrund ihrer Länge erforderlich sein, beispielsweise zum Einführen eines Werkstücks durch eine Öffnung. Auch große Maschinen, die oft aus großen, mit niedrigeren Frequenzen schwingenden Bauteilen bestehen, neigen zu Vibrationen. Bei diesen Anwendungen treten Schwingungen in der Endposition des Motors auf. Die Schwingungsdämpfungstechnologie im Servoverstärker reduziert diese Maschinenschwingungen deutlich.
MPC in einem Doppelmotor-Servosystem
Die Anwendung von MPC auf einen einachsigen Aktor ist unkompliziert, und Abweichungen vom exakten Sollprofil sind bei Punkt-zu-Punkt-Bewegungen unerheblich. Sind jedoch zwei Servoachsen mechanisch miteinander verbunden, beeinflussen sich ihre Bewegungsprofile gegenseitig. Ein Beispiel hierfür ist ein Kugelgewindetrieb mit zwei Motoren.
Diese Konfiguration mit zwei Motoren kann in größeren Anwendungen von Vorteil sein, bei denen das zum Beschleunigen des Motorrotors benötigte Drehmoment erheblich ist und ein einzelner, größerer Motor das erforderliche Drehmoment und die Beschleunigung nicht erbringen könnte. Aus Sicht der Abstimmung ist der entscheidende Faktor, dass zwei relativ große Servomotoren eine schwere Last positionieren und nahezu mit Nenndrehmoment und -drehzahl arbeiten. Wenn die Motoren nicht mehr synchronisiert sind, wird ihr Drehmoment im Wesentlichen verschwendet, da sie um die Position konkurrieren. Sind jedoch die Verstärkungen beider Servos gleich, sind auch die Verzögerungen der modellprädiktiven Regelung gleich, und die Motoren bleiben synchron.
Der erste Schritt bei der Optimierung einer solchen Anwendung besteht darin, einen der Motoren physisch zu entfernen und das System wie gewohnt mit nur einem Motor abzustimmen. Ein Servomotor reicht für eine stabile Achsensteuerung aus, liefert aber nicht genügend Drehmoment für das erforderliche Profil. In diesem Fall wird die automatische Abstimmungssequenz des Herstellers verwendet, die einen Trägheitsparameter festlegt und die modellprädiktive Regelung (MPC) aktiviert. Hinweis: Die mit einem Motor ermittelte Systemverstärkung muss letztendlich gleichmäßig auf beide Motoren verteilt werden. Der Trägheitsparameter vereinfacht diesen Schritt, da er als Skalierungsfaktor für die Servoreglerverstärkungen dient. Daher wird er in jedem Verstärker auf die Hälfte des ursprünglichen Abstimmungsergebnisses eingestellt. Das verbleibende Abstimmungsergebnis kann dann von Achse eins auf Achse zwei übertragen werden. Die letzte Anpassung besteht darin, die Integrationskomponente von Achse zwei zu entfernen – dem zweiten Motor wird die Rolle der „Beschleunigungsunterstützung“ zugewiesen, während die kleinen Integrationskorrekturen nur für Motor eins gelten.
Das Optimierungskonzept für diese Anwendung umfasst zwei Phasen. In der ersten Phase wird jede Achse einzeln mithilfe der vom Hersteller bereitgestellten automatischen Optimierungsfunktion als Ausgangspunkt optimiert und die modellprädiktive Regelung aktiviert. Zusätzlich wird eine Schwingungsdämpfung angewendet. Am Ende dieser Phase weist jede Achse ein sauberes und gleichmäßiges Ansprechverhalten mit minimalen Vibrationen auf.
In der zweiten Phase werden die Achsen gemeinsam bewegt, wobei der Fehler während eines Probelaufs aus Sicht des Reglers überwacht wird. Ausgehend von gleich eingestellten MPC-Verstärkungen werden durch Ausprobieren die optimalen Einstellungen für eine MPC-Verstärkung ermittelt, die ein Gleichgewicht zwischen geringem und gleichmäßigem Positionsfehler sowie einer gleichmäßigen Bewegung herstellt. Das Prinzip besteht darin, dass bei gleichem Positionsfehler beide Achsen um die gleiche Zeit verzögert werden und das Werkstück trotz des hohen Positionsfehlers während der Bewegung auf die korrekten Maße zugeschnitten wird.
Veröffentlichungsdatum: 28. April 2019