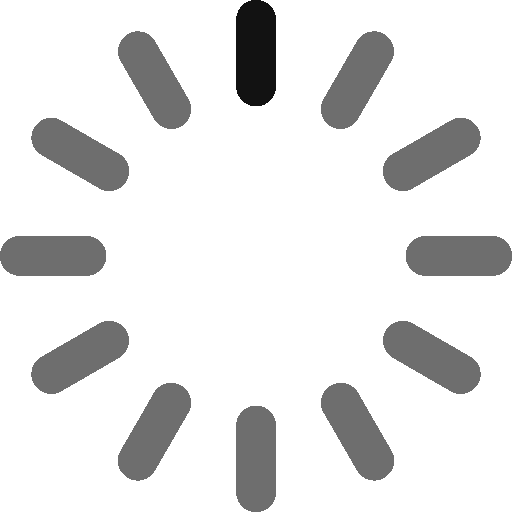Die Automatisierung hat in nahezu allen Bereichen der Fertigung Einzug gehalten. Nähen stellte jedoch traditionell eine Herausforderung für Industrieroboter und andere Automatisierungswerkzeuge dar. Neue Fortschritte in der Automatisierungstechnologie erweitern nun die Möglichkeiten der Automatisierung für Nähmaschinenhersteller, selbst für Näharbeiten, die bisher als zu komplex für die Automatisierung galten.
Einführung in Nähroboter
Automatisiertes Nähen bezeichnet den Einsatz von Robotern für industrielle und gewerbliche Nähaufgaben, wie beispielsweise das Nähen von Leder, Stoffen und Wolle. Jedes dieser Materialien stellt besondere Herausforderungen dar, doch die Aussicht auf höhere Produktionsraten, Effizienz und Zuverlässigkeit hat Roboterhersteller dazu veranlasst, Lösungen für die anspruchsvollsten Herausforderungen der Branche zu entwickeln.
Die Textilindustrie nutzt Automatisierung bereits seit über 100 Jahren, allerdings beschränkte sich deren Einsatz bisher meist auf einfache Aufgaben wie das Zuschneiden. In den letzten Jahren sind jedoch neue Produkte auf den Markt gekommen, die diese Einschränkungen beheben.
Warum ist Nähen so schwierig?
Die für den Umgang mit losen, feinen Stofffäden erforderliche Geschicklichkeit und Präzision sind mechanisch nur schwer zu erreichen. Die Fäden neigen zum Verrutschen, Ausrichten und Dehnen. Zudem weisen Stoffe häufig Unregelmäßigkeiten auf, die beim Nähen feine Korrekturen erfordern.
Die aktuelle Generation der Bildverarbeitung und die Fortschritte bei Roboter-Endeffektoren (den „Händen“ des Roboters) eröffnen Textilherstellern völlig neue Möglichkeiten. Bildverarbeitung ermöglicht es Robotern, auf Materialprobleme zu reagieren, indem sie quasi „sehen“, wenn sich der Stoff verschiebt oder Falten wirft, und so Korrekturen vornehmen. Verbesserungen bei der Roboterbewegung und den Endeffektoren ermöglichen eine immer präzisere Steuerung. Funktionen wie die Drehmomentregelung vermitteln ein Gefühl für den richtigen Druck und die richtige Spannung, die auf das Material ausgeübt werden.
Wie das Nähen mit Robotern funktioniert
Tatsächlich ist das Nähen mit Robotern eine Nischenanwendung im Bereich der Automatisierung mit spezifischen Anforderungen. So werden beispielsweise viele Nähroboter speziell nach den Vorgaben eines Unternehmens gefertigt – eine Universallösung wie in anderen Branchen gibt es nicht. Nähroboter benötigen zudem spezielle Mechanismen zum Vernähen verschiedener Materialien, wie etwa Nähköpfe, zusätzliche Greifer sowie mehrere Roboterarme und Endeffektoren.
Arten von Nährobotern
Wie in jeder anderen Branche eignen sich auch für Nähanwendungen nur bestimmte Robotertypen. Sie sind häufig mit speziellen Optionen ausgestattet, die eigens für die Herausforderungen des industriellen Nähens entwickelt wurden, darunter:
1. Sechsachsige Industrieroboter
2. Kollaborative Roboter
3. Kartesische Roboter
4. Zweiarmroboter
Vergleich verschiedener Nähoptionen
Hersteller, die ihre Nähprozesse automatisieren möchten, haben je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung und des Unternehmens verschiedene Möglichkeiten.
Automatisierungslösungen für Nähmaschinen ermöglichen Herstellern die Steigerung ihrer Produktionskapazität auf vielfältige Weise. Robotik erhöht Durchsatz, Konsistenz und Wiederholgenauigkeit. Diese Robotersysteme reduzieren in der Regel Abfall und Ausfallzeiten und steigern so die Produktivität. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Optionen:
Kartesische Roboter
Kartesische Roboter (siehe Abbildung oben) sind große, hochskalierbare Maschinen. Diese weit verbreiteten Systeme werden für Nähprozesse jeder Größenordnung eingesetzt. Sie nähen mehrere Produkte gleichzeitig mit verschiedenen Nähkopfaufsätzen. Darüber hinaus verfügen diese Systeme über hochpräzise Konstruktion, um gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Es gibt jedoch auch Nachteile. Kartesische Roboter sind große, komplexe Industriemaschinen und können im Vergleich zu anderen Optionen teuer sein.
Gelenkarme
Sechsachsige, kollaborative Zweiarmroboter stellen eine weitere Automatisierungslösung dar. Diese Roboter gehören zur Gruppe der Gelenkarmroboter. Dank ihrer hohen Beweglichkeit eignen sie sich ideal für filigrane Aufgaben wie Nähen, bei denen widerspenstige Stoffe Feinmotorik erfordern. Da sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind, lassen sie sich leicht umprogrammieren und für andere Aufgaben einsetzen. Diese Roboter sind so anpassungsfähig, dass ein Näh-Cobot problemlos auch zum Schweißen verwendet werden kann. Man tauscht einfach den Endeffektor gegen einen schweißgeeigneteren aus, und schon kann er umprogrammiert werden. Ein kartesischer Roboter hingegen ist speziell für einen bestimmten Zweck konstruiert und erfordert für den Einsatz in einer neuen Anwendung, wie beispielsweise dem Plasmaschneiden, eine umfassende Überarbeitung der mechanischen Komponenten. Ein weiterer Vorteil von Cobots ist ihre Kollaborationsfähigkeit: Sie sind so konzipiert, dass sie in der Nähe von Menschen mit einem geringeren Verletzungsrisiko arbeiten können.
Selbst hochgradig anpassungsfähige Roboterarme haben jedoch ihre Grenzen. Sie lassen sich nicht so gut wie kartesische Roboter skalieren und können typischerweise nicht mehrere Kleidungsstücke gleichzeitig nähen. Auch die Geschwindigkeit und Präzision kartesischer Roboter erreichen sie nicht.
Wie man einen Nähroboter integriert
Vielleicht sind Sie jetzt schon begeistert von der Aussicht, einen Teil Ihres Nähprozesses zu automatisieren. Um jedoch eine fundierte Entscheidung zu treffen, sind noch einige wichtige Schritte zu beachten.
Definieren Sie den Umfang Ihres Projekts
Der wichtigste Teil des Prozesses beginnt, wenig überraschend, am Anfang. Die präzise Definition des Projektumfangs trägt maßgeblich zu einer erfolgreichen Umsetzung bei. Dabei sollten Sie Faktoren wie die folgenden berücksichtigen:
1. Details und Eigenschaften Ihres Produkts
2. Die genauen Schritte des Produktionsprozesses erläutern.
3. Definieren Sie Kennzahlen und Leistungsindikatoren (KPIs) für den aktuellen Prozess (Produktionsrate, Effizienz, Verfügbarkeit usw.) und das gewünschte Ergebnis nach der Automatisierung.
4. Ermitteln Sie die tatsächlichen Kosten des Prozesses (Rohstoffe, Arbeitskräfte usw.).
5. Legen Sie Ihr verfügbares Budget fest.
Veröffentlichungsdatum: 06.03.2023