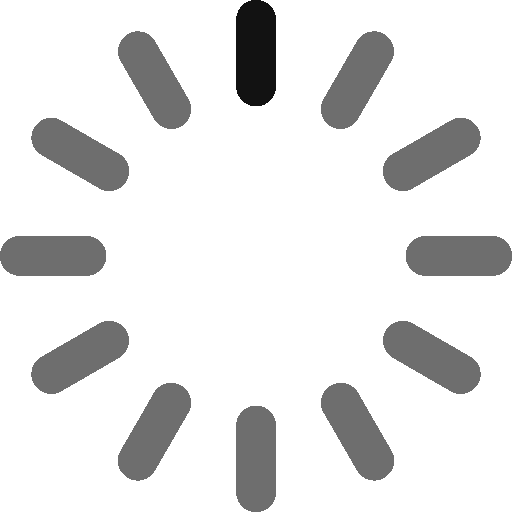Die Geschwindigkeit hängt in erster Linie vom Antriebsmechanismus ab.
Wie bei vielen Begriffen in der Lineartechnik – etwa „hochbelastbar“, „miniaturisiert“ und „korrosionsbeständig“ – gibt es auch hier keinen Industriestandard, der definiert, was einen „Hochgeschwindigkeits“-Linearantrieb ausmacht. Dennoch orientieren sich Hersteller bei der Klassifizierung und Vermarktung ihrer Antriebe als Hochgeschwindigkeitsantriebe an einigen allgemeinen Richtlinien. Diese Richtlinien basieren typischerweise auf dem Antriebsmechanismus, dem Antriebstyp und sogar dem primären Anwendungsbereich bzw. der Branche. Das Verständnis dieser Unterschiede hilft Ihnen, eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn Ihre Anwendung einen „Hochgeschwindigkeits“-Linearantrieb erfordert.
Die Drehzahl eines Aktuators wird typischerweise durch den Antriebsmechanismus begrenzt. Kugelgewindetriebe und Trapezgewindetriebe stoßen aufgrund ihrer Neigung zum Pendeln an ihre Grenzen, die vom Durchmesser, der Länge und der Anordnung der Endlager abhängt. Da Trapezgewindetriebe auf Gleitkontakt basieren und durch Reibung hohe Wärme erzeugen, erreichen sie oft niedrigere Maximaldrehzahlen als Kugelgewindetriebe ähnlicher Größe. Daher gelten Aktuatoren mit Kugelgewindetrieben eher als „Hochgeschwindigkeitsaktuatoren“ als solche mit Trapezgewindetrieben.
Aktuatoren mit Riemenantrieb oder Zahnstangenantrieb erreichen typischerweise höhere Geschwindigkeiten als Kugelgewindetriebe, vorausgesetzt, sie sind korrekt gespannt (bei Riemenantrieben) bzw. vorgespannt (bei Zahnstangenantrieben). Aktuatoren mit stahlverstärkten Riemen können Geschwindigkeiten von 10 m/s und mehr erreichen, während zahnstangengetriebene Aktuatoren üblicherweise Geschwindigkeiten von 5 m/s erzielen.
Ein weiterer Faktor bei der Betrachtung von Hochgeschwindigkeits-Linearantrieben ist der Antriebstyp. Die Bezeichnung „Hochgeschwindigkeit“ wird meist für Schubstangenantriebe – auch als elektrische Zylinder bekannt – verwendet, da deren Hauptanwendungen Schub-/Zug- und Einschubvorgänge umfassen, die typischerweise sehr kurze Aus- und Einfahrzeiten erfordern. Diese Antriebe können entweder über eine Kugelumlaufspindel oder eine Gewindespindel angetrieben werden und Geschwindigkeiten von 0,1 m/s bis über 1 m/s erreichen. Einige Hersteller bieten sogar riemengetriebene Schubstangenantriebe an, die Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 m/s erreichen können.
Schlitten- oder Wagenantriebe (auch als stangenlose Antriebe bezeichnet) erreichen in vielen Fällen sogar höhere Geschwindigkeiten als Stangenantriebe. Da sie jedoch primär für Positionierung und Transport, typischerweise mit hohen Lasten, eingesetzt werden, werden sie seltener als „Hochgeschwindigkeitsantriebe“ vermarktet. Für stangenlose oder Schlittenantriebe stehen vielfältige Antriebsoptionen zur Verfügung, darunter Gewindespindel, Kugelgewindetrieb, Zahnstange und Ritzel, Riemenantrieb und Linearmotor.
Linearmotoren bieten prinzipiell höchste Geschwindigkeiten, da sie keine mechanischen Teile besitzen, die die Geschwindigkeit begrenzen oder Reibung und Wärme erzeugen könnten. In Kombination mit einem Linearantrieb ist ihre Geschwindigkeit jedoch durch die Führungsgeschwindigkeit begrenzt. Auch stahlverstärkte Riemenantriebe erreichen Geschwindigkeiten von über 12 m/s, sind aber wie Linearmotoren durch die maximale Führungsgeschwindigkeit eingeschränkt. Die gängigsten Führungssysteme für Linearmotoren und Riemenantriebe sind Profilkugellager mit Umlauffunktion, deren maximale Geschwindigkeiten typischerweise bis zu 5 m/s betragen. Dadurch ist die Gesamtgeschwindigkeit des Aktuators auf maximal 5 m/s begrenzt.
Höhere Geschwindigkeiten lassen sich jedoch erzielen, wenn Riemenantriebe mit Kurvenrollenführungen anstelle von Profilkugellagern kombiniert werden. Mit vorgespannten Kurvenrollenführungen und einem korrekt gespannten, stahlverstärkten Riemenantrieb erreichen diese Hochgeschwindigkeits-Linearantriebe Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 10 m/s und sind damit deutlich überlegen.
Veröffentlichungsdatum: 17. August 2020