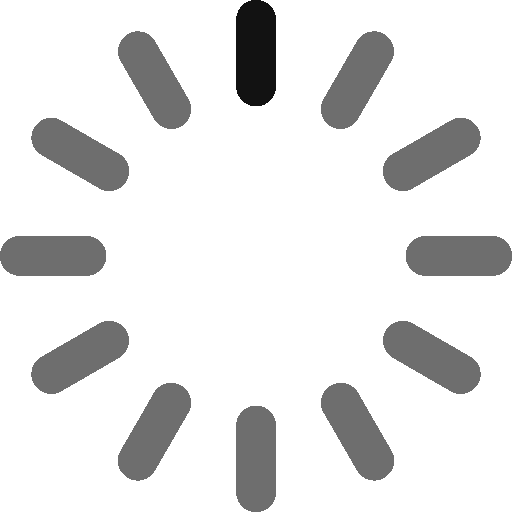Komplette Linearmotor-Einheiten – inklusive Grundplatte, Linearmotor, Linearführungen, Encoder und Steuerung.
Lineare Servomotoren mit Direktantrieb erfreuen sich in den letzten Jahren zunehmender Beliebtheit, was unter anderem auf die Nachfrage der Anwender nach höherem Durchsatz und besserer Präzision zurückzuführen ist. Linearmotoren sind zwar vor allem für ihre Fähigkeit bekannt, hohe Geschwindigkeiten, lange Hübe und eine exzellente Positioniergenauigkeit zu kombinieren, die mit anderen Antriebsmechanismen nicht möglich ist, sie ermöglichen aber auch extrem langsame, gleichmäßige und präzise Bewegungen. Tatsächlich bietet die Linearmotortechnologie ein so breites Spektrum an Möglichkeiten – Schubkraft, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Positioniergenauigkeit und Wiederholgenauigkeit –, dass es nur wenige Anwendungen gibt, für die Linearmotoren keine geeignete Lösung darstellen.
Zu den Varianten von Linearmotoren gehören Linearservomotoren, Linearschrittmotoren, Linearinduktionsmotoren und Schubrohr-Linearmotoren. Wenn ein Linearservomotor die beste Option für eine Anwendung darstellt, sollten bei der ersten Auswahl drei Punkte berücksichtigt werden.
Die „primäre“ Überlegung: Eisenkern oder eisenlos?
Lineare Direktantriebs-Servomotoren gibt es in zwei Haupttypen: mit Eisenkern und ohne Eisenkern. Der Unterschied liegt darin, ob die Wicklungen im Primärteil (analog zum Stator eines Rotationsmotors) in einem Eisenblechstapel oder in Epoxidharz eingebettet sind. Die Entscheidung, ob ein Linearmotor mit Eisenkern oder ohne Eisenkern für die jeweilige Anwendung erforderlich ist, ist in der Regel der erste Schritt bei der Konstruktion und Auswahl.
Linearmotoren mit Eisenkern eignen sich optimal für Anwendungen, die extrem hohe Schubkräfte erfordern. Dies liegt daran, dass die Lamellen des Primärteils Zähne (Vorsprünge) aufweisen, die den elektromagnetischen Fluss auf die Magnete des Sekundärteils (analog zum Rotor eines Rotationsmotors) fokussieren. Diese magnetische Anziehung zwischen dem Eisen im Primärteil und den Permanentmagneten im Sekundärteil ermöglicht es dem Motor, hohe Kräfte zu erzeugen.
Eisenlose Linearmotoren weisen im Allgemeinen eine geringere Schubkraft auf und eignen sich daher nicht für die extrem hohen Schubkraftanforderungen, die beispielsweise beim Pressen, Bearbeiten oder Formen auftreten. Ihre Stärken liegen jedoch in der Hochgeschwindigkeitsmontage und im Hochgeschwindigkeitstransport.
Der Nachteil der Eisenkernkonstruktion liegt im Rastmoment, das die Laufruhe beeinträchtigt. Rastmomente entstehen, weil die geschlitzte Struktur des Primärteils dazu führt, dass dieses beim Gleiten entlang der Magnete des Sekundärteils bevorzugte Positionen einnimmt. Um die Ausrichtungstendenz des Primärteils an den Magneten des Sekundärteils auszugleichen, muss der Motor mehr Kraft aufbringen, was zu einer Geschwindigkeitswelligkeit – dem sogenannten Rastmoment – führt. Diese Kraft- und Geschwindigkeitsschwankungen beeinträchtigen die Laufruhe, was insbesondere in Anwendungen problematisch sein kann, bei denen die Bewegungsqualität während des gesamten Fahrvorgangs (und nicht nur die Endpositioniergenauigkeit) wichtig ist.
Es gibt zahlreiche Methoden, mit denen Hersteller das Rastmoment reduzieren. Ein gängiger Ansatz besteht darin, die Position der Magnete (oder der Zähne) zu verändern, wodurch sanftere Übergänge beim Überfahren der Sekundärmagnete durch die Primärzähne entstehen. Ein ähnlicher Effekt lässt sich durch die Formgebung der Magnete zu einem länglichen Achteck erzielen.
Eine weitere Methode zur Reduzierung des Rastmoments ist die sogenannte Teilwicklung. Bei dieser Konstruktion besitzt die Primärwicklung mehr Lamellenzähne als die Sekundärwicklung Magnete, und der Lamellenstapel hat eine spezielle Form. Diese beiden Modifikationen wirken zusammen, um Rastkräfte zu kompensieren. Und natürlich bietet auch Software eine Lösung. Anti-Rast-Algorithmen ermöglichen es Servoantrieben und Steuerungen, den Strom in der Primärwicklung so anzupassen, dass Kraft- und Geschwindigkeitsschwankungen minimiert werden.
Eisenlose Linearmotoren weisen kein Rastmoment auf, da ihre Primärspulen in Epoxidharz vergossen und nicht um ein Stahlblech gewickelt sind. Zudem haben eisenlose Linearservomotoren eine geringere Masse (Epoxidharz ist leichter, wenn auch weniger steif als Stahl), wodurch sie einige der höchsten Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Maximalgeschwindigkeitswerte in elektromechanischen Systemen erreichen. Auch die Einschwingzeiten sind bei eisenlosen Motoren typischerweise kürzer als bei Motoren mit Eisenkern. Durch den Verzicht auf Stahl in der Primärwicklung und die damit verbundene Vermeidung von Rastmoment und Geschwindigkeitsschwankungen ermöglichen eisenlose Linearmotoren sehr langsame und gleichmäßige Bewegungen mit einer Geschwindigkeitsabweichung von typischerweise unter 0,01 Prozent.
Welcher Integrationsgrad?
Wie Rotationsmotoren sind auch Linearservomotoren nur eine Komponente eines Bewegungssystems. Ein vollständiges Linearmotorsystem benötigt außerdem Lager zur Lastaufnahme und -führung, ein Kabelmanagement, eine Rückmeldung (typischerweise einen Linear-Encoder) sowie einen Servoantrieb und eine Steuerung. Erfahrene OEMs und Maschinenbauer oder Unternehmen mit sehr speziellen Design- oder Leistungsanforderungen können mit internen Fertigungskapazitäten und Standardkomponenten verschiedener Hersteller ein komplettes System realisieren.
Die Konstruktion von Linearmotorsystemen ist im Vergleich zu Systemen mit Riemen, Zahnstangen oder Spindeln deutlich einfacher. Es gibt weniger Bauteile und weniger arbeitsintensive Montageschritte (keine Ausrichtung von Kugelgewindetrieben oder Riemenspannung). Da Linearmotoren berührungslos arbeiten, entfällt die Notwendigkeit der Schmierung, Justierung und sonstigen Wartung des Antriebs. Für OEMs und Maschinenbauer, die eine Komplettlösung suchen, gibt es jedoch zahlreiche Optionen für komplette, linearmotorgetriebene Aktuatoren, hochpräzise Positioniertische und sogar kartesische und Portalsysteme.
Ist die Umgebung für einen Linearmotor geeignet?
Linearmotoren sind in anspruchsvollen Umgebungen wie Reinräumen und Vakuumumgebungen oft die bevorzugte Lösung, da sie weniger bewegliche Teile besitzen und mit nahezu jeder Art von Linearführung oder Kabelmanagement kombiniert werden können, um die Anforderungen an Partikelerzeugung, Ausgasung und Temperatur der jeweiligen Anwendung zu erfüllen. In Extremfällen kann die Sekundärkomponente (Magnetbahn) als bewegliches Teil dienen, während die Primärkomponente (Wicklungen, einschließlich Kabel und Kabelmanagement) stationär bleibt.
Besteht die Umgebung jedoch aus Metallspänen, Metallstaub oder Metallpartikeln, ist ein Linearservomotor möglicherweise nicht die beste Wahl. Dies gilt insbesondere für Linearmotoren mit Eisenkern, da deren Bauweise bauartbedingt offen ist und die Magnetbahn somit Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die halboffene Bauweise von Linearmotoren ohne Eisenkern bietet zwar einen besseren Schutz, jedoch ist darauf zu achten, dass der Schlitz im Sekundärteil nicht direkt mit Verunreinigungen in Berührung kommt. Es gibt zwar Konstruktionsoptionen zur Gehäuseung sowohl von Linearmotoren mit als auch ohne Eisenkern, diese können jedoch die Wärmeableitung des Motors beeinträchtigen und somit unter Umständen ein Problem durch ein anderes ersetzen.
Veröffentlichungsdatum: 03.04.2024