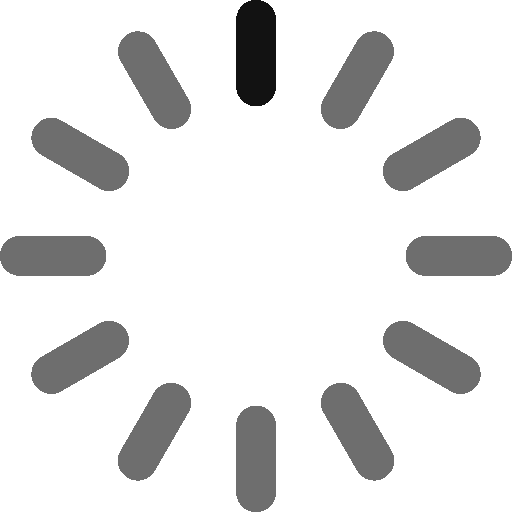Stille bedeutet ein schnelleres und längeres Leben.
Synchronriemen sind in Antriebssystemen weit verbreitet und bieten im Vergleich zu Ketten einen ruhigeren Lauf und eine bessere Hochgeschwindigkeitsleistung. Zudem vermeiden sie die Probleme von Schlupf und Dehnung, die Keilriemen in Präzisionsanwendungen beeinträchtigen können. Ein Nachteil von Synchronriemen, auch Zahnriemen genannt, ist jedoch die Geräuschentwicklung. Obwohl sie leiser sind als ein Kettenantrieb, können Synchronriemen dennoch Geräusche erzeugen, die für manche Anwendungen und Umgebungen inakzeptabel sind.
Das Geräusch eines Synchronriemens entsteht hauptsächlich durch genau das Merkmal, das Synchronriemen gegenüber Ketten- oder Keilriemen so vorteilhaft macht: den Eingriff von Riemen und Riemenscheibe. Zunächst erzeugt der einfache Aufprall des Riemens auf die Riemenscheibe ein Geräusch, das oft mit einem „klatschenden“ Geräusch verglichen wird und besonders bei niedrigen Riemendrehzahlen deutlich wahrnehmbar ist. Zweitens wird beim Eingriff der Riemenzähne in die Riemenscheibenrillen Luft zwischen den beiden Bauteilen eingeschlossen und entweicht dann wieder. Dabei entsteht ein Geräusch, das an das Entweichen von Luft aus einem Ballon erinnert. Dieses Phänomen trägt maßgeblich zum Riemengeräusch bei höheren Drehzahlen bei.
Ein weiterer Faktor, der zu Geräuschen bei Synchronriemen beiträgt, ist die Riemenspannung. Synchronriemen werden typischerweise unter hoher Spannung betrieben und neigen daher leicht zum Schwingen (ähnlich einer gezupften Gitarrensaite). Auch die Materialien von Riemen und Riemenscheiben spielen eine Rolle. So erzeugen Polyurethanriemen in der Regel mehr Geräusche als Neoprenriemen (Gummi), und Polycarbonat-Riemenscheiben (thermoplastisches Polymer) sind tendenziell lauter als Metallriemenscheiben. Die von den Riemenscheiben erzeugten Geräusche hängen auch von der Maßgenauigkeit der Riemenscheibe ab, welche die Laufruhe der Riemenzähne in den Riemenscheibenrillen bestimmt.
Die Auswirkungen dieser verschiedenen Faktoren zusammengenommen können leicht zu einem riemengetriebenen System führen, das unangenehme oder sogar gesundheitsschädliche Geräusche erzeugt – insbesondere, wenn mehrere Riemensysteme in unmittelbarer Nähe laufen. Es gibt jedoch Möglichkeiten, den Geräuschpegel von Synchronriemen zu reduzieren.
Aus Sicht der Dimensionierung und Konstruktion hängt die Geräuschentwicklung eines Synchronriemens direkt von der Riemenbreite und der Riemendrehzahl ab. (Breitere Riemen neigen stärker zu Resonanzen, und höhere Riemendrehzahlen erzeugen nicht nur mehr, sondern auch höherfrequente Geräusche.) Die Geräuschentwicklung verhält sich umgekehrt proportional zum Riemenscheibendurchmesser. Daher gibt es einige einfache Möglichkeiten zur Geräuschreduzierung – sofern die Anwendung dies zulässt –, beispielsweise die Riemendrehzahl zu verringern, einen schmaleren Riemen zu verwenden oder eine Riemenscheibe mit größerem Durchmesser einzusetzen.
Aus Montage- und Betriebssicht lässt sich die Geräuschentwicklung reduzieren, indem man auf die korrekte Ausrichtung der Riemenscheiben achtet. Winkelabweichungen (Parallelität der Riemenscheibenwellen) können nämlich zu Kontakt zwischen Riemen und Riemenscheibenflanschen führen. Ist der Riemen zudem nicht richtig gespannt, kann es zu unerwünschten Reibungsbewegungen zwischen den Riemenzähnen und den Riemenscheibenrillen kommen, was ebenfalls zu unnötigen Geräuschen beiträgt.
Manche Hersteller bieten Synchronriemen an, die als geräuscharm ausgelegt sind. Fertigungstechnisch lässt sich die Geräuschentwicklung durch eine Nylonbeschichtung der Zahnseite des Riemens reduzieren, wodurch die beim Eingriff entstehenden Geräusche minimiert werden. Zusätzlich sorgen Nuten in der Riemenscheibe für einen Unterdruck, durch den die Luft beim Eingriff von Riemen und Riemenscheibe entweichen kann.
Eine weitere geräuscharme Modifikation besteht in der Veränderung der Zahngeometrie, um den Rollvorgang beim Eingriff der Riemenzähne in die Riemenscheibe zu optimieren. Eine solche Konstruktion verwendet ein sogenanntes „versetztes Doppelhelixmuster“ für die Riemenzähne. Bei dieser Konstruktion besitzt der Riemen zwei nebeneinanderliegende Zahnreihen, die jedoch um 180 Grad versetzt sind. Dadurch ist die Frequenz des von der einen Zahnreihe (einer Riemenseite) erzeugten Geräuschs um 180 Grad phasenverschoben zur Frequenz des von der anderen Seite erzeugten Geräuschs, wodurch sich die Geräusche effektiv aufheben.
Veröffentlichungsdatum: 10. Februar 2020